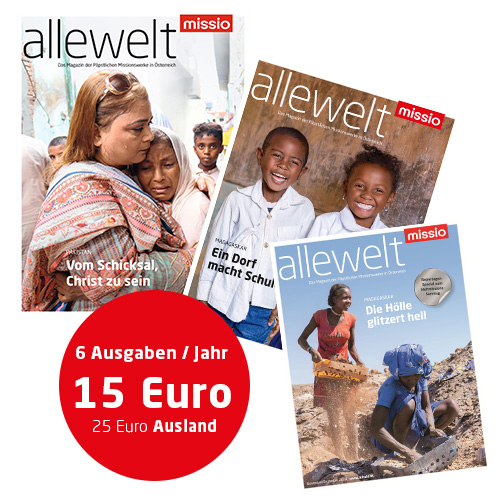Weiblich, christlich, mutig – und bedroht
Dies ist die Geschichte dreier junger Christinnen aus Syrien: Hineingeboren in eine brutale Diktatur, trotzten sie zwölf Jahren Krieg und blieben stark. Was aber wird jetzt, nach der Machtergreifung der Islamisten, aus ihnen? Eine Spurensuche in Damaskus.
Reportage zum Anhören
Der Kontakt zu Maria ist abgerissen. Die Spur hat sich verloren. Wir wissen aktuell nicht, was mit ihr geschehen ist.“ Die Nachricht aus Damaskus klingt dramatisch und sie ist es wohl auch. Viel ist in der Zwischenzeit passiert. Zu viel. Die Herrschaft der Assads, die Syrien 54 Jahre lang in einem eisernen Würgegriff hielten, wirkt plötzlich fast wie eine Fußnote der Geschichte. Dafür flimmern die Bilder der neuen Machthaber über die Schirme: Männer in verschlissenen Tarnanzügen mit langen Bärten und Kalaschnikows. Untermalt von „Allahu akbar“-Schreien, ballern sie in die Luft und lassen mit jeder ihrer Gesten erkennen, dass sie die neuen Herrscher Syriens sind. Und irgendwo darin ist Maria? Diese junge, eloquente Christin, diese Frau, die ganz genau zu wissen schien, was sie vom Leben will. Was ist aus ihr geworden? Aus ihr und den anderen Christinnen in dieser Wiege des Glaubens.
Marias Reich des Schönen
Rückblende in den Mai des Jahres 2023. Maria al-Samaan, weiße Sneakers, Bluejeans, weißes T-Shirt und lange schwarze Locken, posiert für Fotos vor ihrem Salon am Rande von Damaskus. Sie wirkt gelöst, hat Spaß an dieser kurzen Flucht aus dem Alltag. Mit ihrem Selbstbewusstsein kaschiert sie gut die Schwere, die über ihrem Leben liegt. Sie ist dreißig und drinnen, in dem Geschäft an der Straßenecke, breitet sich auf ein paar Quadratmetern ihr kleines Reich der Schönheit aus. Gemütlich soll es sein, hat sie gesagt, denn immerhin verbringt sie darin fast ihre gesamte Zeit. Und tatsächlich, zwischen all den perfekt arrangierten Beauty-Produkten glaubt man sich bald an einem anderen Ort, weit weg von der Realität dort draußen. „Vor ein paar Jahren“, sagt Maria, „ist das Haus von einer Rakete getroffen worden. Dreimal explodierten in unserem Viertel Autobomben. Und einmal schlug eine Rakete direkt bei uns an der Uni ein. Eine meiner besten Freundinnen starb dabei.“
Marias Syrien, das war ein Land im zwölften Jahr des Krieges, ein Trümmermeer, ein Leichenschauhaus mit mehr als einer halben Million Toten. Was als Aufstand gegen den Machthaber Baschar al-Assad begonnen hatte, artete aus in ein Schlachtfeld fremder Mächte, auf dem Islamisten bald ihren „heiligen Krieg“ ausfochten. Maria, die an der Uni Bauingenieurwesen studiert hat, ist das älteste von fünf Kindern. Der Vater bereits in Pension, die Mutter an Krebs erkrankt, spürt sie die Verantwortung, für alle sorgen zu müssen. Trotz Bomben und Raketen kämpfte sie sich durch das Studium, schloss es ab und begann in der staatlichen Telekomfirma zu arbeiten. Doch das Gehalt blieb winzig, die Inflation horrend und Maria fing an, nebenbei Geld dazuzuverdienen. Reichen Frauen machte sie fortan die Nägel und ergriff die Chance, als eine christliche Hilfsorganisation Mikrokredite vergab. So entstand ihr Salon und der dazu passende Slogan fiel ihr auch gleich ein: „Die Welt kann ich nicht ändern, aber ihre Nägel!“ Mit der Politik, das wiederholt sie im Gespräch mehrmals, will sie nichts zu tun haben. Viel wichtiger ist ihr der Glaube, der ihr in all den Momenten der Schwere Stütze bleibt. „Ohne das Gebet, ohne das Wissen um und Hoffen auf Jesus“, sagt sie, „hätte ich nichts von dem, was gelungen ist, geschafft.“
Der Weg nach Damaskus
Wie so viele andere Christen schöpft auch Maria Kraft aus der jahrtausendealten Geschichte ihrer Heimatstadt. Damaskus hat seit jeher eine tiefe Bedeutung für den Glauben. „Hananias!“, so erfahren wir aus der Apostelgeschichte, hatte der Herr einst zu einem seiner Jünger in Damaskus gerufen: „Steh auf und geh zur sogenannten Geraden Straße, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade.“ Hananias tat, wie ihm geheißen, und was folgte, war die größte Verwandlung des Neuen Testaments. Bis heute zieht sich die Via Recta, wie sie die Römer einst tauften, fast schnurgerade durch das Herz der Altstadt. An ihren Rändern fädeln sich Kirchen der einzelnen christlichen Gemeinschaften auf. Wer abbiegt, stößt auf Wandmosaike und Marienschreine. Und hoch oben, über den mittelalterlichen Erkern und ihren hölzernen Fensterläden, richtet auf dem Dach eine Jesus-Statue ihre Arme gen Himmel. Einem Wunder gleich blieb all das erhalten, überdauerte den Mörserbeschuss und bildet bis heute das christliche Viertel im Zentrum der ältesten dauerhaft bewohnten Stadt der Welt. Dass die Christen, die vor Beginn des Krieges zehn Prozent der Bevölkerung Syriens ausmachten, ungemein stolz auf dieses Erbe sind, flackert in jedem Gespräch auf.
Maria 2.0, aber anders
„Wir als Christen sind diejenigen, die in Syrien für Frieden stehen, für Offenheit, für Toleranz“, sagt eine weitere junge Frau namens Maria. Sie sitzt in einer Art Atrium in einem der Häuser der Altstadt. „Meine Mama sagt immer, es sei unsere Mission, als Christen hier zu sein für dieses Land, für unser Erbe.“ Die Studentin ist 25 und damit fünf Jahre jünger als ihre Namensschwester, die Nageldesignerin. Die beiden Marias verbindet nicht nur derselbe Name, sondern auch das gleiche Schicksal des Krieges und die Kraft des Glaubens.
„Ich sah Dinge, die ich nie im Leben hätte sehen sollen, von Schrapnellen zerfetzte Körper, die vor mir auf der Straße lagen. Manchmal…“, sagt sie, „verließen wir in der Früh als Familie unser Haus und wussten nicht, ob wir einander alle am Abend wiedersehen würden.“ Und doch blieb auch sie stark, kümmerte sich in ihrer Pfarre um kleine Kinder, sammelte mit Freunden Kleidung für sie und nahm ihnen beim Spielen die Angst, die auch sie empfand. „Als ich selbst dunkle Stunden erlebte“, sagt Maria, „spendete mir die Barmherzigkeit, die ich zu geben versuchte, ein besonderes Licht.“ Schon damals aber, in diesem Frühsommer des Jahres 2023, treibt Maria ein Gedanke um, der sie nicht mehr loslässt. Sie spürt, wie das Leben an ihr vorbeizieht, wie erst der Krieg und dann der wirtschaftliche Niedergang ihr jede Zukunft rauben. Damaskus, diese einst so glänzende Stadt, ist zu einem Ort der Fäulnis und Verwesung verkommen. Weg, sagt Maria, ja weg will sie, nur noch raus aus diesem Gefängnis, zu dem ihr eigenes Land für sie längst mutiert ist. „Aber meine Eltern lassen mich nicht“, sagt sie zugleich, „sie fürchten um mich.“ Also paukt sie weiter, büffelt Englisch und hofft, dass der Tag kommen wird, an dem dieses Syrien ein anderes, ein besseres sein wird, oder sie in der Fremde das findet, was ihre Heimat ihr vorenthält.
Christines Traum in Weiß
Als Bab Tuma, das Tor des Apostels Thomas, wie es bis heute auf Arabisch heißt, mitsamt der Altstadt im Rückspiegel des Wagens verschwindet, folgt die absolute Vernichtung: Pulverisierte Häuserzeilen, ein filigranes Geflecht aus zertrümmerten Ziegeln und zerborstenem Beton. Es sind die einstigen Herde des Aufstands gegen Assad, die vom Regime wie Eiterbeulen ausgemerzt wurden, ohne dass dort auch nur ein Hauch von Leben übrig wäre. Solche Stalingrads unserer Zeit wechseln bei der Fahrt durch Damaskus ständig die Szenerie mit weitgehend intakt gebliebenen Wohnvierteln, in denen die Orangenbäume blühen.
In einem solchen Viertel hat Christine Fanouneh Unterschlupf gefunden. Sie ist 39, hat ein Diplom in englischer Literatur und ist eine passionierte Schneiderin. Was zu jenem Traum in Weiß führt, in dem sie ihre Besucher begrüßt. Aus Stoffen aller Art zaubert Christine Kleider, die ihren zukünftigen Trägerinnen wie angegossen stehen. „Es ist meine Passion, mein kleines Glück, Menschen in Zeiten wie diesen Momente der Freude zu schenken. Eine Erinnerung an ihr einstiges Leben, als sie sich zurechtmachten, schön anzogen, ausgingen“, sagt sie. Der Krieg hat diese Welt ins Dunkle gestürzt und Christine ist die Kerze darin. Wie die beiden Marias ist auch sie eine Kämpferin, eine, die sich ihre eigenen Wunden nicht anmerken lässt und die ihr Glaube davor bewahrte, komplett abzustürzen. Mit ihrem Gewerbe verdient sie zumindest genug, um ihrer Mutter und dem jüngeren Bruder mit Down-Syndrom unter die Arme zu greifen.
Die Islamisten als Herrscher
Und nun der Sprung. Knapp 18 Monate später. In eine andere Welt. Assad ist nicht mehr. Am Ende sackte sein Regime zusammen wie eine Hülle ohne Inhalt, wie ein krankes Königreich ohne Krieger. Erst fiel Aleppo, die Handelsmetropole im Norden, an die Islamisten von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), einem Bündnis, hervorgegangen aus der Terrororganisation Al-Kaida. Danach sollte es nicht einmal 14 Tage dauern, bevor auch Assad selbst Geschichte war, still und heimlich entflohen ins Moskauer Exil, und die Islamisten ohne Widerstände Damaskus einnahmen. Deren Anführer Ahmed al-Scharaa, eben noch auf den Terrorfahndungslisten des Westens, bezog Assads Palast und gab sich in ersten Interviews handzahm. „Kein zweites Afghanistan“ würde dieses neue Syrien nun werden, versprach er. Wenngleich die Provinz Idlib, die er mit seinen Männern zuvor über Jahre hinweg beherrscht hat, durchaus einem solchen glich: Scharia, Peitschenstrafen, Exekutionen, Folter. Frauenrechte? Fehlanzeige. Was heißt das für Syriens christliche Minderheit, besonders für die Frauen? Assads Staat war, das darf nicht vergessen werden, eine säkular geführte Diktatur, in der Frauen – von der Kleidung bis zum Studium – kaum eingeschränkt waren. Was bedeutet es für Christine und die beiden Marias? 18 Monate sind vergangen. Und eine von ihnen hat Syrien seither bereits verlassen.
Assads Staat war, das darf nicht vergessen werden, eine säkular geführte Diktatur, in der Frauen – von der Kleidung bis zum Studium – kaum eingeschränkt waren. Was bedeutet es für Christine und die beiden Marias? 18 Monate sind vergangen. Und eine von ihnen hat Syrien seither bereits verlassen.
Angst, Furcht und Hoffnung
Maria, die Studentin, ist die Erste, von der ein Update eintrifft. Ihr Diplom in Betriebswirtschaft hat sie geschafft. Sonst aber sei wenig so gekommen, wie sie es sich erhofft hätte. Sie berichtet, die ersten drei Tage nach der Machtergreifung durch die Islamisten nicht einmal geschlafen zu haben. Zu Weihnachten traute sie sich kaum in die Kirche, weil sie damit rechnete, dort zum Ziel von Anschlägen der Radikalen zu werden. „Als meine Schwester und ich beschlossen, uns schließlich doch raus zum Gebet zu wagen, waren in der Christmette nur 40 Leute, was uns nicht überraschte, so groß war die Angst.“ Ihre Mutter, so berichtet sie, mache sich nun Vorwürfe, Maria früher davon abgehalten zu haben, das Land zu verlassen. „Jetzt wünscht sie sich nichts sehnlicher, als dass ihre Töchter dem Chaos, in dem wir leben, entkommen.“ Abends verlässt die Familie das Haus nicht mehr. Berichte und Videos von Übergriffen der Kämpfer auf Minderheiten kursieren in den sozialen Medien. „Meine größte Angst ist, für immer in einem Land mit unsicherer Zukunft festzusitzen, da Syrien ein gefährliches Schlachtfeld bleiben wird, um das Länder wie Israel und die Türkei kämpfen.“ Und so will Maria die Konsequenzen daraus ziehen: „Ich bin jetzt 27 Jahre alt, 14 davon habe ich im Krieg verbracht, ständig in Angst gelebt. Ich träume davon, eine Familie zu haben und will nicht, dass meine Kinder in solch einer Unsicherheit aufwachsen.“ Sobald es irgendwie möglich sei, werde sie Syrien ver-lassen. „Und damit bin ich nicht allein. So schön dieses Land ist, mit seinen Kirchen und seinem reichen Erbe, aber alle christlichen Familien, die wir kennen, warten nur auf die eine Gelegenheit, rauszukommen.“
Hat die andere Maria das schon gewagt? Anfangs ist jede Verbindung zur Nageldesignerin abgebrochen. Keiner der Kontakte in Damaskus weiß, was mit ihr passiert ist. Ihr Beauty-Salon ist verwaist und wird bald von jemand anderem übernommen, heißt es. Aber Maria, diese energiegeladene junge Frau, bleibt wie verschwunden. Bis es über Umwege doch gelingt, sie zu finden. In Italien sei sie, schreibt Maria, ihr ginge es gut, Details zu ihrem Leben dort wolle sie aber keine nennen. Vieles bleibt im Vagen, verworren, im Verborgenen der veränderten Verhältnisse.
Und schließlich Christine, die Schneiderin. „Erst“, so erzählt sie, „war da Angst.“ Angst vor dem, was da kommt. Angst vor dem, wofür die neuen Machthaber stehen. Doch so wie sie die Jahre des Kriegs überwand, glaubt sie längst, für alles gerüstet zu sein. Inzwischen habe sie viel Neues gelernt und sei nun neben Einzelstücken auch in der Lage, Massenware zu produzieren – von der Uniform bis zum Pyjama, erzählt sie. Sie überlege, ein eigenes, größeres Geschäft anzumieten, wo sie ihre Kleidung künftig präsentieren könne. Bleiben, so sagt sie, würde sie auf jeden Fall. Ihrer Familie und auch des Glaubens wegen. Denn Damaskus, so klingt es bei ihr, sei eben nicht Idlib. Und der Weg nach Damaskus könne, so wie einst bei Paulus, alle verändern – selbst einen Islamisten?

Syriens dezimierte Christen
Syrien gilt als eine der Wiegen des Christentums. Saulus wurde in Damaskus zum Apostel Paulus. Bis zur Ausbreitung des Islam im 7. Jahrhundert blieb das Gebiet mehrheitlich christlich. Vor Beginn des Bürgerkriegs stellten die zwölf verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Niedrige Geburtenraten und hohe Auswanderquoten beschleunigen seither einen dramatischen Rückgang.