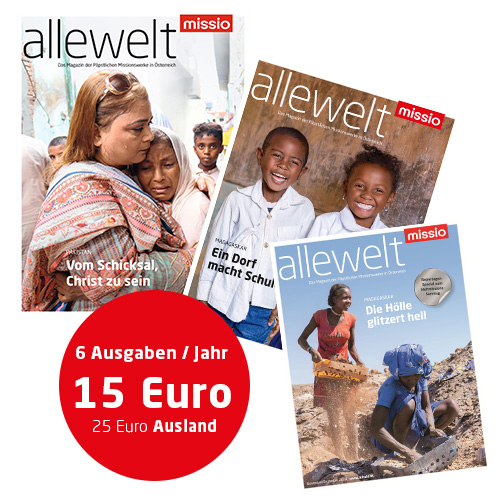Der Taifun aus Tigray
Wie ein Vietnamese in Äthiopien zum Priester wurde, er dort dem Krieg trotzte und nun wie ein Wirbelwind für Heilung sorgt. Die fast schon unglaubliche Geschichte des Father Luan.
Wie macht er das? Woher nimmt er die Kraft? Muss der nicht auch irgendwann mal müde werden? Unweigerlich ertappt man sich bei solchen Gedanken, nachdem man seit Stunden versucht, mit Father Luan Schritt zu halten. Dabei hat einen der 43-Jährige schon vor dem Frühstück abgehängt. Stieg man selbst gegen sieben Uhr aus dem Bett und rieb sich müde die Augen, war er bereits seit drei Stunden wach, hat Rosenkranz gebetet, Mails beantwortet, zwei Espressi getrunken und eine Kalkulation für ein Solar-Ausbildungszentrum um 300.000 US-Dollar durchgerechnet.
Äthiopiens „Club Med“
Damit ist der Takt vorgegeben. Im selben Tempo geht es weiter. „Am besten gleich runter zur Bäckerei“, meint Father Luan, „dann erwischen wir dort noch die Frauen.“ Auf geht die Tür, der Blick schweift über den Campus der Salesianer: feingestutzte Hecken, in voller Blüte stehende Bougainvilleen, Kieselwege – ein Hauch von „Club Med“ mitten in Äthiopien. Das ist Father Luans Reich, sein Bollwerk gegen das Chaos dort draußen. Und dann die Geschichten dahinter. Blitzblank die Bäckerei, mit Frauen am Ofen, bei denen jeder Handgriff sitzt. 5.000 Stück Brot backen sie jeden Morgen. Sie alle sind Opfer eines brutalen Krieges, der fern der Weltöffentlichkeit bis vor zwei Jahren in der Region Tigray tobte, Hunderttausende tötete und Millionen vertrieb.
Den Frauen wurde dabei Ärgstes angetan: von Soldaten verschleppt, vergewaltigt und zuletzt von den eigenen Familien verstoßen. Father Luan gab 35 von ihnen mit dem Brotbacken eine Perspektive, ein Einkommen, einen rettenden Strohhalm zurück ins Leben. „Ich musste etwas für sie tun“, erklärt er, „und versuchen, all das Schlimme in deren Leben in etwas Gutes zu verwandeln.“ Gebacken haben sie seither jeden Tag, auch im Krieg, als der Strom fehlte und sie die Brote über Feuer fertigten.
Father Luan, klein, drahtig, mit wachsamem Blick, drängt zum Aufbruch. Unten warten die Mädchen und Burschen auf ihren Dienst in den Werkstätten. Und tatsächlich, fast schon militärisch stehen sie Spalier, als er das Kreuzzeichen macht und mit ihnen betet. Nach 16 Jahren in Äthiopien spricht der gebürtige Vietnamese längst die Landessprache Amharisch und auch das lokale Tigrinisch geht ihm immer besser von den Lippen. Nachdem er mit den Jugendlichen seine Gedanken zum Tag geteilt hat, machen sie sich auf in die Werkstätten.
Diese verteilen sich über das gewaltige Areal der Salesianer, das italienische Missionare in der Stadt Adwa in Tigray vor 30 Jahren errichteten. Wie ein Wirbelwind führt Father Luan durch die einzelnen Bereiche und erläutert die Ideen dahinter. In der Näherei sollen junge Menschen innerhalb von zwei Monaten eine Ausbildung bekommen, die ihnen hilft, danach rasch Geld zu verdienen. „Im Krieg blieben die Schulen geschlossen“, erläutert er. „Nun haben wir viele Junge, die ganz dringend ein Einkommen brauchen, aber kaum Fertigkeiten haben. Das wollen wir ändern.“
„Es war ein Saustall“
Länger dauern die Kurse in den Werkstätten für Elektriker und Schweißer, wo Trainer fokussiert mit den Jugendlichen arbeiten. Alles ist aufgeräumt, vom Schraubenzieher bis zum Hammer hat jedes Werkzeug seinen genau definierten Platz. „Als ich hierherkam, war das ein Saustall“, erinnert sich Father Luan, „selbst die Ausbildner hielten keine Ordnung. Aber man muss als Vorbild führen, Regeln setzen und dafür sorgen, dass sie alle einhalten.“
Mit 78 Mitarbeitern auf dem Areal von Don Bosco in Adwa ist Father Luan längst Priester und Manager in Personalunion. Und was für einer! Ständig kommen ihm neue Ideen, probiert er Dinge und versucht vieles, um jungen Menschen in einem vom Krieg gepeinigten Gebiet Perspektiven zu geben. „Ich mag keine Meetings, diese ständigen Besprechungen“, sagt er, „ich will lieber etwas tun, was weiterbringen, nicht nur reden.“
So ist er gerade daran, das einzige Trainingszentrum für Solarenergie in Tigray aufzubauen. Weshalb er schon frühmorgens besagten 300.000-Dollar-Plan kalkulierte. Einmal, als er zumindest zu Mittag ein Nickerchen hielt, bekam er nach dem Aufwachen Lust auf ein Eis. „Ich suchte also auf YouTube Videos, wie man sowas selbst herstellt.“ 15 Minuten später trommelte er seine Leute zusammen und schon am nächsten Tag ging Adwas einzige Eisproduktion in Betrieb und macht seither gute Gewinne, die ihm dabei helfen, andere Programme zu finanzieren. Etwa drei Psychologinnen, die Menschen aus ihren Kriegstraumata führen. So geht alles bei den Salesianern ineinander über: die Ausbildung für die Jungen, das Training für die Opfer des Krieges, die Betreuung von deren Kindern in der hauseigenen Krippe.
Äthiopien als letzte Wahl
Was sich bislang wie eine perfekte Geschichte liest, in der alles gelingt, ist in Wahrheit hart erkämpft. Luan wuchs in Vietnam auf. Ein katholisches Kind in einem kommunistischen Land. Früh spürte er seine Berufung. Als er elf war, wäre er fast entführt worden und hatte sein Erweckungserlebnis beim Blick auf eine Statue der Jungfrau Maria. Ab da war für ihn sein Weg klar. Als Novize im Salesianer-Orden wollte er in die Mission aufbrechen. Der Rektor zeigte später eine Liste an Ländern, die zur Auswahl standen: Sie reichte von China, der Mongolei, Argentinien, dem Nahen Osten, bis nach Sambia und eben Äthiopien. Während die anderen noch abwogen, Vor- und Nachteile einzelner Ziele diskutierten, sagte Luan gleich, er würde nehmen, was übrigbliebe. So begann vor 16 Jahren sein äthiopisches Abenteuer in der Stadt Dilla. „Von dem Land, ja eigentlich von ganz Afrika, hatte ich zuvor kein konkretes Bild“, erinnert er sich. „Klar, der Unterschied zu Asien ist gewaltig, aber letztlich gilt doch überall das Gleiche“, sagt er und lacht. „Dich darf nichts schockieren und du musst für alles offen sein, am meisten für die Menschen.“ Eine Lektion, die Father Luan nach seiner Priesterweihe, die 2016 in Äthiopien stattfand, stets für sich beherzigte. Auch als es darum ging, ihn an eine neue Wirkungsstätte zu entsenden. „Ich geh‘ überall hin, außer nach Adwa“, sagte er seinem Provinzial.
Denn vorherige Besuche dort hatten selbst ihn, den Umtriebigen, ratlos zurückgelassen. „Es war ein Desaster, ungepflegt, ungeordnet, das Gras stand mir bis zur Hüfte“, erinnert er sich. Ähnlich sah es wohl auch sein Provinzial, weshalb er es für geboten hielt, einen wahren Taifun hinauf nach Tigray zu schicken. „Als ich es erfuhr, musste ich mich darauf einlassen und das Beste daraus machen. Gehorsam ist Pflicht im Orden.“
Mit dem Leben abgeschlossen
Die Ankunft in Adwa? Härter als erwartet. Erst kam die Corona-Pandemie, die auch in Äthiopien das Leben zum Erliegen brachte, und bald folgte der Krieg: Regierungstruppen, verbündet mit dem Nachbarland Eritrea, gegen die Miliz der abgesetzten Regionalregierung. Die vom Rest der Welt kaum wahrgenommenen Folgen – millionenfaches Leid, Vertreibung, eine von der Zentralregierung durch Nahrungsboykott hervorgerufene Hungersnot und mindestens eine halbe Million Tote. Father Luan wies alle Angebote zurück, als Ausländer ausgeflogen zu werden, und blieb an der Seite der ihm Anvertrauten. Als die Soldaten auf Adwa vorrückten, vergrub er seinen Pass, rief seine Schwester in Vietnam an und verabschiedete sich von ihr. Für immer, wie er dachte. Father Luan nahm den Tabernakel, scharte jene, die nicht geflohen waren, um sich, und stieg mit ihnen in einen der Keller der Werkstätten. Dort beteten sie und warteten. Bis Regierungssoldaten vor ihnen standen. „Warum seid ihr geblieben, während alle anderen davonliefen?“, fragten sie verwundert den Priester mit vorgehaltenem Gewehr. „Aus irgendeinem Grund kannten sie die Salesianer, hatten in ihrer Heimatregion mit unserem Orden gute Erfahrungen gemacht“, erinnert sich Father Luan. „Sie fragten: ,Don Bosco, seid ihr das?‘ Als ich bejahte, ließen sie uns in Ruhe.“
Doch Adwa blieb übersät von Spuren des Krieges. Sichtbaren und unsichtbaren. Das wird klar, sobald Father Luan einen Teil des in der Früh gebackenen Brotes in einen Geländewagen hievt und sein Salesianer-Reich hinter sich lässt. Ausgebrannte Autowracks zeigen, wie hart um die Stadt gekämpft wurde. Die Besatzerarmeen wechselten einander ab und jede zog eine noch tiefere Schneise aus Blut und Leid. Eine riesige Textilfabrik, in der zuvor 7.000 Menschen Arbeit gefunden hatten, wurde aus der Luft bombardiert. „Als ich davon erfuhr, musste ich weinen“, sagt Father Luan, als er durch die nun leere Halle streift, in der noch die Nähmaschinen lagern. „Diese Fabrik war das industrielle Herz von Adwa. Viele der Jungen aus unseren Werkstätten hatten hier zuvor ihren ersten Job gefunden.“
Father Luans Antrieb
Schließlich hält Father Luan vor einem halbfertigen Rohbau. Rauch steigt auf, Familien mit Kindern umringen ihn. Es sind Hunderte von Vertriebenen aus dem Westen von Tigray. Sie alle hätten laut dem Friedensabkommen, das im November 2022 den Krieg offiziell beendete, längst in ihre Dörfer zurückkehren dürfen. Doch in der Realität zeigt sich, was die Versprechen von Politikern wert sind. So kauern die Frauen mit ihren Kindern weiter in ihren selbstgezimmerten Verschlägen im Inneren des Rohbaus. Father Luan bewahrt sie davor, darin zu verhungern. „Wir müssten viel mehr für sie tun“, sagt er später fast schon vorwurfsvoll, „man soll den Menschen ja nicht den Fisch liefern, sondern ihnen das Fischen beibringen.“ Aber die Not ist ein Meer, das selbst ihn zu verschlingen droht.
So versucht Father Luan dort zu helfen, wo das Leid am größten ist. Für fünf Frauen, die Schrecklichstes erdulden mussten, hat er im Stadtzentrum eine leere Verkaufsfläche angemietet. Ein nettes kleines Restaurant soll darin entstehen, das ihnen nicht nur Beschäftigung, sondern auch den Sinn in einem Leben zurückgibt, das zuvor fast ausgelöscht worden wäre. Anpacker, wie er einer ist, stemmt Father Luan selbst den Kühlschrank für das Lokal aus dem Wagen und hat längst Pläne ausgearbeitet, wie es darin aussehen soll. Ein paar Straßen weiter konnte er mit Spendengeldern ein kleines Haus pachten. Darin hat er weitere Frauen mit ihren Kindern einquartiert, die von der eigenen Familie verstoßen wurden, nachdem Soldaten sie im Krieg vergewaltigt hatten.
„Es soll für sie ein Ort der Ruhe sein, wo sie miteinander einen Weg zurück ins Leben finden können“, erklärt er. „Die Frauen kommen regelmäßig zur Trauma-Therapie zu uns ins Zentrum und mit der Zeit, wenn ihre Wunden heilen, werden sie eine Perspektive bekommen.“
Tief aus seinem Glauben heraus steht er so an der Seite der Schwächsten, der Gebeutelten, derer, die sonst keinen Fürsprecher mehr hätten und bleibt trotz all ihrer Geschichten des Leids, die auf ihn hereinprasseln, immer positiv. „Der Herr“, sagt er, „hätte nicht gewollt, dass wir verzagen, uns fürchten und verkriechen. Er ist es, der mir die Kraft gibt, weiterzumachen. All das ist sein Werk, nicht meines.“

Der Tigray-Krieg
Zwischen November 2020 und 2022 ging Äthiopiens Armee, verbündet mit jener des Nachbarlands Eritrea und Milizen aus der Amhara-Region, gegen die Tigray People’s Liberation Front (TPLF) vor. Ursache waren Machtstreitigkeiten nach Absetzung der TPLF in der nordäthiopischen Region Tigray durch Premier Aby Ahmed. Bis zu einer halben Million Menschen starben, zwei Millionen wurden vertrieben, die humanitäre Krise, eine Hungersnot und politische Spannungen in Tigray halten bis heute an.