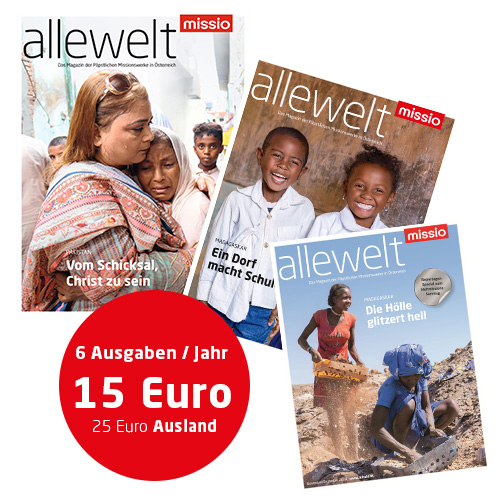Ausgehungert
Hellen hat nichts zu essen, kein sauberes Wasser oder gar Strom, dafür fünf hungrige Kinder und jede Hoffnung verloren. Wer kann Hellen und zig solcher Mütter in einem gescheiterten Staat wie dem Südsudan helfen?
Reportage zum Anhören:
„Es muss …“, sagt Hellen, „… irgendwann angefangen haben, nachdem er gegangen war. Einfach verschwunden ist er, untergetaucht, vielleicht mit einer anderen irgendwo was Neues angefangen.“ Traurig blickt die Frau zu Boden, ahnt es nur und will es auch gar nicht genauer wissen. Hellen hockt in dem Haus aus Lehm, das noch er gebaut hat. Er, ihr verschollener Ehemann.
Hellens Not
Das Haus sieht so aus, wie Kinder eines zeichnen: eine kleine Tür, rechts davon ein Fenster, darüber ein Dach aus Wellblechplatten. Mehr nicht – und doch weit mehr als die meisten hier haben. „Weil er bei der Armee war“, spricht sie nun doch wieder von ihm, „aber selbst dort gab es die letzten sieben Monate keinen Sold mehr.“ Rund um Hellens Haus stehen Hütten, manche aus Holz, andere aus Lehm, einige überhaupt nur Buden aus Blech.
Ein Dorf am Rande von Südsudans Hauptstadt Juba ist Hellens Zuhause. Dort, wo sich der Weiße Nil träge in Richtung Norden schleppt und die Stadt langsam ausfranst. Auch wenn Juba selbst in seinem Zentrum wenig Städtisches aufweist: kaum eine der Straßen ist asphaltiert, Strom kommt bestenfalls aus Generatoren, eine Kanalisation hat es noch nie gegeben, ebenso wenig wie einen echten Staat, der sich darum kümmern könnte. Der Südsudan ist zwar das jüngste Land der Welt, doch mit der Unabhängigkeit vom muslimisch dominierten Norden im Jahr 2011 verlagerte sich die Gewalt ins Innere: Jubas Politiker-Kaste war fortan vornehmlich damit beschäftigt, ihre eigene Pfründe zu sichern und Gegner mit Waffengewalt in Schach zu halten. Das Resultat: im Human Development Index, einem internationalen Indikator, der Lebenserwartung, Bildung und Einkommen widerspiegelt, liegt der Südsudan hinter allen Staaten der Welt auf dem letzten Platz. Nirgendwo anders ist es so schwer, Tag für Tag ein Auslangen zu finden.
Hellen spürt das. Auch wenn sie, wie viele Frauen ihrer Generation, weder lesen noch schreiben lernte, ist sie mit ihren 28 Jahren äußerst firm. Ihr Häuschen ist aufgeräumt und sauber. Jede Schüssel und jeder Teller haben ihren Platz. Und trotzdem geriet alles ins Rutschen. „Christopher, mein Ältester, ist sechs“, sagt Hellen und tätschelt stolz den Kopf des Buben. „Er merkt natürlich, dass sein Vater fehlt, aber er weiß auch, dass er nun umso mehr auf seine Schwestern achtgeben muss.“ Denn nach ihm gebar Hellen vier weitere Kinder: Elizabeth Santa, Emanuela, Lilian und zuletzt Mary, die gerade ein halbes Jahr alt ist. „Kurz nachdem sie zur Welt kam, ist mein Mann verschwunden, hat mich mit den Kindern alleingelassen. Danach fing es an …“
Blätter statt Brei
Was Hellen mit dem „es“ umschreibt, ist kein Besucher, der sich höflich ankündigen würde. Dennoch ist er fast überall im Südsudan präsent. Er kommt schleichend, kriecht in jede der Hütten, setzt sich fest und wird zu einem stillen, aber erbarmungslosen Begleiter. „Anfangs, als noch etwas Geld da war“, sagt Hellen, „kochte ich viel mit Bohnen. Ich kaufte sie billig in einem großen Topf auf dem Markt, rationierte sie und versuchte so viel wie möglich daraus zu machen. Für die Kleinen gab es dazu noch Brei aus Maniok.“ Doch bald neigten sich die letzten Ersparnisse dem Ende zu. Hellens Mann blieb weiter verschwunden. Sie musste sich um ihre Kleinsten kümmern und der ungebetene Gast in ihrem Haus wurde zunehmend gieriger. Christopher, der Bub, konnte nicht länger zur Schule gehen.
Die Gebühren von umgerechnet etwa 16 Euro pro Semester waren für Hellen beim besten Willen nicht mehr aufbringbar. Selbst der große Topf Bohnen, den sie früher für 0,65 Euro am Markt erworben hatte, wurde für sie bald unleistbar. „Ich habe versucht, zumindest aus dem Gemüse, das ich rund um das Häuschen anbaue, für die Kinder etwas zu kochen. Aber es reichte nicht.“ Hellen selbst hatte zu diesem Zeitpunkt längst aufgehört, regelmäßig zu essen. Abends, wenn ihre Kinder schliefen, machte sie sich über dem Feuer etwas Wasser heiß, gab Pflanzenblätter, die sie zuvor im Wald gesammelt hatte, dazu und trank diese Brühe Schluck für Schluck aus. Dann kroch sie unter die Decke zu ihren Kindern, der Magen verkrümmt wie ein verknoteter Fahrradschlauch ohne Luft darin. „Anfangs quengelten die Kleinen noch, riefen ‚Mama, Hunger, Mama, essen‘, aber auch das“, erinnert sie sich, „hörte irgendwann auf.“
Geld muss her, irgendwie
In den Nächten, in denen Hellen hungrig neben ihren dösenden Kleinen wach lag, betete sie zum Herrn und flehte um Hilfe. Später zermarterte sie sich den Kopf, wie sich Geld heranschaffen ließe. Und irgendwann kam ihr die Idee. Gemeinsam mit ihren Nachbarinnen, denen es kaum besser ging, die aber wegen ihrer Kinder ebenso wenig in der Stadt arbeiten konnten, fing sie an Bier zu brauen. Stolz zeigen zwei von ihnen nun die gelben Kanister mit dem gepanschten Alkohol und die Feuerstelle, über der sie das Gesöff rühren. Dieses dürfte zwar weit vom Reinheitsgebot für Bier entfernt sein, dafür lässt es sich aber ganz gut entlang der Hauptstraße an durstige Männer verkaufen. Das verdiente Geld half, dass ihre Kinder nicht verhungerten. Den ungebetenen Gast aber ganz aus dem Haus zu schmeißen, davon blieb Hellen weit entfernt.
Endlich essen!
Suzan Laku Lomin steht in einer Ausspeisung für Babys und Kleinkinder und wirft einen letzten prüfenden Blick über Dutzende von farbigen Tellerchen, die sich vor ihr auf einer Matte ausbreiten. Darin dampfen frischgekochter Reis und ein sattmachender Brei.
„Die Unterernährung von Kleinkindern ist ein schlimmes Übel im Südsudan“, erklärt Suzan, „sie führt zu Störungen beim Wachstum, schwächt das Immunsystem und erhöht die Anfälligkeit für Krankheiten wie Durchfall oder Lungenentzündungen.“ Suzan ist als ausgebildetete Ernährungsexpertin im Südsudan eine Sensation. Sie hat Hunderte solcher Kinder gesehen, mit ihren knöchrigen kleinen Körpern, aus denen die Rippen hervortreten, den spindeldürren Armen, den Händen und Füßen, denen jede Kraft abhandenkam und dem so typischen Blähbauch. „Dieser tritt auf, wenn Kinder etwa Mais kriegen und so zwar Kalorien zu sich nehmen, es ihnen aber an Proteinen und Nährstoffen fehlt“, sagt Suzan. „Dadurch sammelt sich Flüssigkeit im Bauchraum, die diesen anschwellen lässt.“ Wegen Missernten, den andauernden gewaltsamen Konflikten im Land und fehlenden landwirtschaftlichen Ressourcen leiden im Südsudan etwa 40 Prozent der Kleinkinder an akuter Unterernährung. Statistisch stirbt eines von zehn Kindern noch bevor es fünf Jahre alt wird.
Und dann treffen sie ein: Die Mütter mit ihren Kindern. Nach einem gemeinsamen Gebet erhalten die Kleinen ihre Essensschälchen und Suzan geht bald im Gewirr unter.
Vor einiger Zeit erfuhr auch Hellen in ihrer Pfarre von der Initiative und nimmt seither mit ihren Kindern den Weg zur Baby-Ausspeisung. Ihre drei Jahre alte Tochter Lilian zählt rasch zu den eifrigsten Esserinnen. „Wir bieten den Kindern eine Mischung aus Linsen, Bohnen und Reis, sowie mitunter Hühnerfleisch und manchmal Fisch“, sagt Suzan, „das ist eine proteinreiche Kost, die deren Defizite ausgleicht. Häufig gibt es auch Marmelade, die besonders viele Kohlenhydrate enthält und so einen Ersatz für Früchte liefert, die sich die Eltern nicht leisten können.“
Die Speisung der Tausend
Dank Spenden finden die kostenlosen Baby-Ausspeisungen dreimal die Woche an drei verschiedenen Orten am Stadtrand von Juba statt. Mehr als 700 Kinder, die als akut unterernährt gelten, erhalten so eine warme, sättigende Mahlzeit. Kaum ist diese vorüber, beginnen Suzan und ihr Team von Helferinnen die Babys und Kleinkinder zu wiegen. Sie messen auch den Umfang ihrer Arme und Beine und stellen so fest, wie sich ihr Zustand verbessert. Die Resultate sind überwältigend: „Nach sechs Monaten sind nur noch knapp acht Prozent der 700 Kinder gefährdet“, sagt Ernährungsexpertin Suzan. In Kursen bringt sie den Müttern bei, wie sie auch zuhause möglichst günstig, aber dennoch nährreich für ihre Kleinsten kochen können und liefert ihnen Tipps zur Hygiene.
Dass es Suzan und diesen Ort überhaupt gibt, verdanken Hellen und die anderen Mütter einem großgewachsenen, schlaksigen Mann, der sich dezent im Hintergrund hält: Doktor Betram Gordon Kuol, von allen Hakim genannt, ist ein Einheimischer und ausgebildeter Agrarökonom mit einem Diplom der deutschen Universität Bonn. Er ist ein Mann, der längst nicht mehr hier sein müsste, der weit entfernt, bei seiner nach Australien ausgewanderten Frau und den Kindern sein könnte, anstatt in der Mittagshitze von Juba mitten unter schreienden Babys zu stehen. „Und doch oder gerade deshalb ist es der richtige Platz“, sagt er, ohne auch nur einen Moment damit zu kokettieren, „denn in einem Land wie Australien gibt es Zehntausende von Menschen mit meinen Kenntnissen, im Südsudan hingegen kann man solche an einer Hand abzählen. Hier kann ich nützlich sein. Hier kann ich helfen, damit es den Menschen, besonders den Kindern, besser geht.“
Auf der Farm der Früchte
Wie er das bewerkstelligt, will Hakim ein paar Kilometer vom Ausspeisungszentrum entfernt vorzeigen. Hinter einem Schranken führt die Route über einen schlammigen Feldweg. Hakim muss ordentlich am Lenkrad des Geländewagens kurbeln, damit er die Kontrolle über sein Fahrzeug behält.
Bis eine ganze Farm inmitten der Wildnis auftaucht. In Reih und Glied sind Felder angelegt zwischen denen einzelne Gewächshäuser stehen. Es gibt Bewässerungsanlagen, Trinkwasserspeicher und bald auch einen eigenen Fischteich. „Hier soll das gedeihen, was nicht nur die Babys und Kleinkinder bei der Ausspeisung als Zusatznahrung erhalten, sondern auch genug Gemüse und Obst wachsen, das wir mit Profit auf dem Markt verkaufen und so unsere anderen Aktivitäten in der Jugendausbildung mitfinanzieren können“, sagt Hakim. Hier spricht der gelernte Agrarökonom, der nicht nur eine Ahnung von Landwirtschaft hat, sondern auch vom Business dahinter. Als solcher leitet er die katholische Vinzenzgemeinschaft im Südsudan, die global gesehen mit über einer Million Mitgliedern die größte Laienorganisation der Welt ist.
Was Hakim antreibt, sind Schicksale wie das von Hellen und ihren Kindern. Das Wissen darum, Menschen in ihrer größten Not und Verzweiflung einen Rettungsanker zuwerfen zu können und sie an einen Ort der Hoffnung zu holen, entschädigt ihn für die Zeit fern seiner Familie, für viele Entsagungen und manches an Ärger. So sehr ihn die Bürokratie in einem von Korruption völlig zerfressenen Staat quält, so oft er sich in deren Räderwerk schon zermalmt glaubt, so lohnend bleibt doch der Wandel, den er in Gang setzt. Als Hellen in ihrer Ausweglosigkeit einst wie jeden Sonntag in die Kirche ging, mit knurrendem Magen in einer der Bänke kauerte und betete, bat sie die Gottesmutter nur um eines: einen Ausweg, einen Schimmer an Hoffnung, der sie weitermachen und stark bleiben lässt. Für sich, aber vor allem für ihre Kinder. Und sie wurde erhört. Hellen träumt nun davon, dass Christopher eines Tages wieder zur Schule gehen kann und sie selbst vielleicht einen Stand auf dem Markt eröffnen wird.

Wie der Südsudan scheiterte
Unter britischer Kolonialherrschaft prägte der arabisch dominierte Norden des Sudans die Entwicklung, der Süden galt als eine Art Naturreservat. Mit der Unabhängigkeit 1956 änderte sich daran wenig. Die mehrheitlich christlichen Schwarzafrikaner des Südens fühlten sich von den meist muslimischen Arabern des Nordens diskriminiert. Es folgte ein mehr als fünf Jahrzehnte dauernder Kampf um die Unabhängigkeit, die 2011 erreicht wurde. Bald brachen verdeckte ethnische Konflikte im jüngsten Staat der Erde aus. Heute gilt der Staat als gescheitert: zwei von drei seiner Bewohnerinnen und Bewohner hungern, allein 1,4 Millionen Kinder sind akut unterernährt.