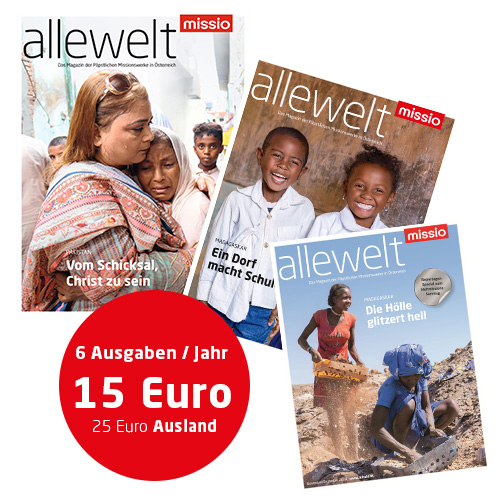Ab an den Amazonas
Papst Franziskus hatte mit „Querida Amazonia“ den Blick auf ein zerbrechliches, bedrohtes Gebiet gelenkt. Nationaldirektor Pater Karl Wallner brach nun auf, um die dortigen Herausforderungen zu verstehen – und traf auf einen Landsmann, der sein ganzes Leben Amazonien vermacht hat: Bischof Erwin Kräutler.
Reportage zum Anhören:
Am Beginn stand bei mir eine große Sehnsucht. In acht Jahren als Missio-Nationaldirektor haben mich die meisten Projektbesuche nach Afrika geführt und ich glaube, die dortigen Herausforderungen gut verstanden zu haben. Ganz anders sind diese in Asien, wo ich mir in Indien, Myanmar und Sri Lanka, aber auch in Pakistan selbst ein Bild machen konnte. Doch Südamerika, worauf in den 1970er- und 1980er-Jahren der große Fokus der europäischen Missionsarbeit lag, kannte ich kaum und das Amazonasgebiet gar nicht. Papst Franziskus hat nach der Amazonas-Synode 2019 klar gesagt, dass wir uns mehr um diese Region kümmern sollen, auch weil es dort zu wenig Priester gibt. In der medialen Verkürzung blieb davon, wie leider so oft, nur das „Frauenpriestertum“ übrig. So wollte ich selbst sehen, wie es dort mit den Berufungen aussieht und was wir als Missio tun können, diese zu fördern. Und dann gab es noch einen weiteren Grund, der mich zum Aufbrechen bewog: Bischof Erwin Kräutler. Ich habe eine Bewunderung für ihn. Besonders nachdem ich alte allewelt-Artikel über ihn las und eine TV-Dokumentation seines Schaffens sah.
Und plötzlich war da Savanne
Wir fuhren also los von Santarém, einer Großstadt mitten am Amazonas. Und ich war wirklich bestürzt, weil die gesamte Stadt schon wochenlang in auch lag. Grund dafür waren die Brandrodungen des Regenwaldes in der Region. Bald erfuhren wir, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, die Hölzer rauszuholen, sondern dass tatsächlich einfach alles niedergebrannt wird, um so schnell wie möglich an Ackerland zu gelangen. Angebaut wird darauf Soja, das kurzfristig großen Gewinn verspricht. Brasilien ist einer der Hauptexporteure von Soja und das Paradoxe ist, dass dieses zum Großteil für die Herstellung von Tierfutter für Schweine und Hühner verwendet wird, aber auch als Biokraftstoff in Form von Sojaöl. Nach einiger Zeit gelangten wir auf eine Straße, die es eigentlich gar nicht geben dürfte: Die „Transamazônica“ durchschneidet den Regenwald als staubige Schneise. Gebaut, um die Rohstoffe wie Edelhölzer, aber auch Gold und natürlich das Soja rauszuschaffen. Bald sahen wir dort, wo einst Regenwald war, die riesigen abgeernteten Felder, staubig, trocken, nur noch Stummel, selbst am Horizont kein einziges Grün. Bei dieser Fahrt fühlte ich mich eher an die Savanne in Teilen von Afrika erinnert als daran, wie ich mir Amazonien vorgestellt hätte. Da begreift man erst, was Franziskus, eben ein Papst aus Südamerika, gemeint hat, als er von „einer Wirtschaft“ sprach, „die tötet“. Wir wissen, dass das plakativ war und dass wir Wirtschaft brauchen, aber vor diesem Hintergrund, dieser unermesslichen Gier und der mit ihr einhergehenden Zerstörung, begreift man es.
Hilfe für die Indigenen
Ich habe mich auf dieser Reise immer wieder hilflos gefühlt. Besonders als wir stehen blieben inmitten dieser gerodeten Flächen, wo dann vielleicht noch ein einziger Urwaldriese, der geschützt ist, herausragte und sonst nichts. 13.000 Quadratkilometer an Regenwald werden in Amazonien pro Jahr gerodet, das ist mehr als ein Sechstel der Fläche von Österreich! Mir war zum Weinen.
Bewegt haben mich die Begegnungen mit Indigenen entlang unserer Route. Schon bisher versuchten wir von Missio, sie zu stärken und ihnen durch Projekte zu helfen. Es geht darum, dass sie von ihrer kleinen Landwirtschaft, die sie oft betreiben, leben können und nicht am Ende auch gezwungen sind, ihre eigenen Waldstücke niederzubrennen, damit sie irgendwie überleben können. Denn dieser Druck besteht, das haben wir immer wieder gehört. Und auch von der Gewalt, die von den Profiteuren der Rodungen ausgeübt wird. Umso wichtiger ist es, sie nicht im Stich zu lassen. So fand ich auch deren Glauben, deren Frömmigkeit beeindruckend. Ich habe wegen der hohen Luftfeuchte nur selten mein Ordensgewand tragen können, weil es sofort durchgeschwitzt gewesen wäre. Aber als ich es tat und somit als „padre“ erkennbar war, sind die Menschen sofort auf mich zugeströmt. Es besteht dort eine tiefe Liebe zum Priestertum.
Bei „Dom Erwin“ am Xingu
Nach vielen Stunden Fahrt kamen wir schließlich am Sitz des emeritierten Bischofs Kräutler in Altamira an und wurden von „Dom Erwin“ herzlich empfangen. Er ist ein äußerst sympathischer Mensch, ausgestattet mit der Nüchternheit eines Vorarlbergers und für die Gläubigen dort eine Lichtgestalt. Ganz so wie Augustinus sagt: Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Er ist tiefgläubig, sehr fromm und ich war überrascht, wie sehr er auch über die Kirche in Österreich auf dem Laufenden ist.
Von außen, gerade auch durch die Medien, kommt es ja bei Kirchenvertretern immer wieder zu diesen Zuschreibungen: der eine stünde da, der andere dort. Das sah man auch jetzt beim Konklave gerade wieder. Wir können über Kirchenpolitik und dieses und jenes, was man alles ändern kann, ohne Ende sprechen – aber wenn kein Glaube da ist, wird nichts funktionieren. Viel wichtiger ist es daher, die Empathie zu verstehen, dass alles, was wir sozial, karitativ oder auch im politischen Einsatz tun, einer großen Beziehung zu Jesus entspringt, ja einer großen Gläubigkeit, auch in einer großen Liebe zu dem, was die Kirche in ihren Sakramenten tut. Wir alle sind Kirche, aber nicht gegen die Bischöfe, nicht gegen die Leitungen, nicht gegen die Sakramente, sondern wir sind Kirche, wir alle sind dieses Gefüge von Verschiedenheit, der Leib, wie Paulus ihn im Zweiten Korintherbrief schildert, mit verschiedenen Gliedern. Gerade deshalb ist die Kirche stark und ein lebendiger Organismus.
Ich selbst bin Kirche
Das sieht man, ähnlich wie in Afrika, auch in Brasilien besonders anhand der Laien, der Katechistinnen und Katechisten. Für sie heißt Glaube eben nicht, ich setzte mich rein in eine Kirche und warte, bis es losgeht, sondern nein, ich selbst bin ganz stark diese Kirche. Die Laien in dieser Rolle zu stärken war daher auch eines der Anliegen von Papst Franziskus in „Querida Amazonia“, seinem Schreiben nach der Amazonas-Synode 2019. Daran hatte Bischof Erwin wesentlichen Anteil.
Daher war es aufregend, als er uns einlud, ihn zu einer Firmung von 72 Erwachsenen zu begleiten. Dabei gab es bestimmte Riten, die er offensichtlich in seiner Zeit eingeführt hatte, die ich auch als Theologe großartig empfand. Wo etwa beim Segensgebet, das der Bischof über die Gläubigen spricht, alle ihre Hände ausbreiten. Alle rufen den Heiligen Geist mit dem Bischof über die Firmlinge herab. Das ist Kirche, das ist Volk Gottes.
Bischof Erwin war schon immer ein Visionär. Er hat frühzeitig die Zerstörungen nicht nur angeprangert, sondern auch aktiv dagegen gekämpft. Und er behielt recht, als er damals bereits warnte, dass der kurzzeitige Profit keinen dauerhaften Wohlstand brächte, ganz im
Gegenteil. Wir bei Missio werden die Kirche am Amazonas nun intensiver unterstützen, auch ein Priesterseminar in Belém. Denn für mich bestätigte sich ganz stark, dass die Kirche dort steht, wo Jesus sie haben wollte: An der Seite der Schwachen, der Ausgegrenzten, derer, die sonst keine Stimme hätten.

Franziskus' Vermächtnis am Amazonas
Papst Franziskus berief 2019 die Amazonas-Synode ein, um die ökologischen, sozialen und pastoralen Herausforderungen der Region zu behandeln. In seinem Schreiben „Querida Amazonia“ (Geliebtes Amazonien) betonte er den Schutz der Umwelt, die Rechte indigener Völker und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Ökologie. Er forderte eine stärkere missionarische Präsenz der Kirche, die kulturelle Vielfalt respektiert und soziale Ungerechtigkeiten bekämpft.